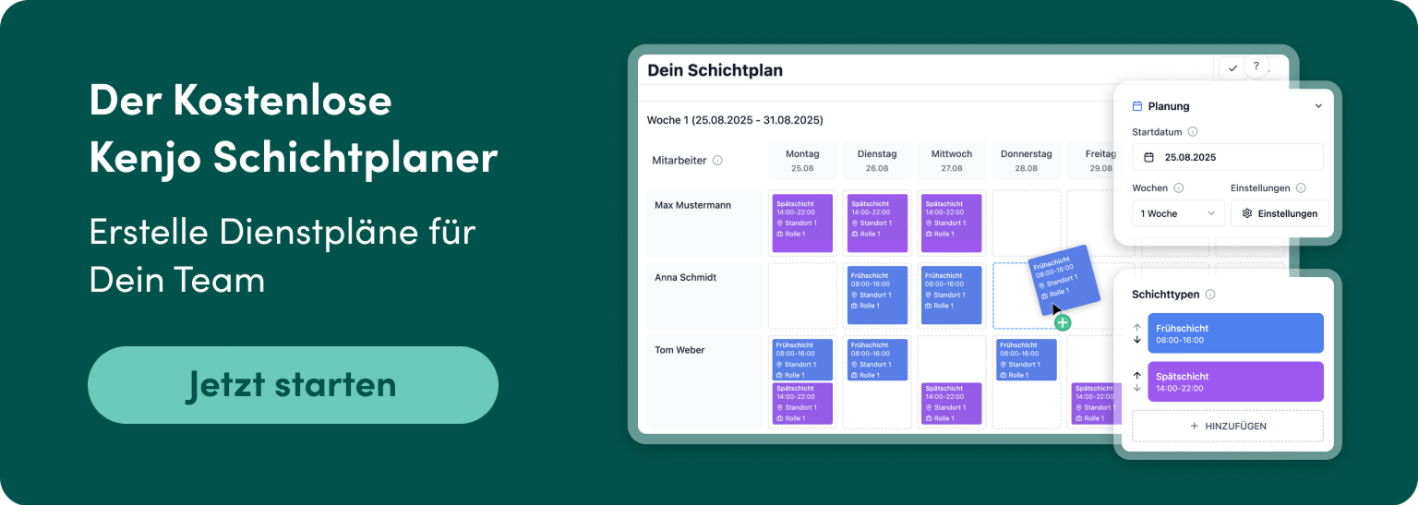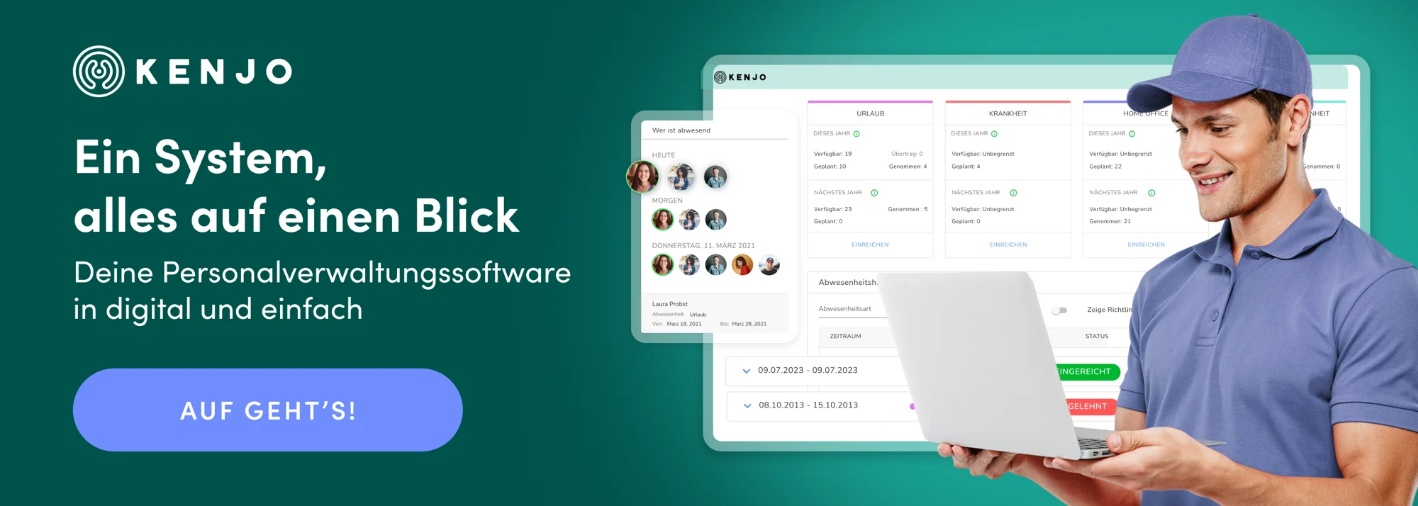.png)
3) Feedback als tägliche Routine etablieren
In vielen Teams gibt es kaum strukturiertes Feedback – höchstens einmal im Jahr im Mitarbeitergespräch oder wenn etwas richtig eskaliert. Für psychologische Sicherheit braucht es aber etwas anderes: kurze, regelmäßige Rückmeldungen im Alltag, die klar, respektvoll und konkret sind. Das gilt für Kritik genauso wie für Anerkennung.
"Es fällt uns unfassbar schwer, eine Rückmeldung zu geben – aus Angst, aus Unvermögen oder aus vielen anderen Gründen." -- Yeter Cetinkilic, Bridgehouse
Du kannst klein anfangen: Zum Ende einer Schicht fünf Minuten einplanen und fragen: „Was lief heute gut, was sollten wir ändern?“ – und wirklich zuhören. Oder nach einer stressigen Woche im Lager: „Was hat Euch diese Woche am meisten belastet – Schichtplanung, Kommunikation, Technik?“ Wichtig ist, dass Rückmeldungen nicht im luftleeren Raum landen, sondern sichtbar Konsequenzen haben (z. B. angepasste Abläufe, klarere Dienstpläne, Schulungen).
Gerade Führungskräfte in der Produktion oder Logistik profitieren davon, wenn sie Feedback geben und annehmen systematisch üben – zum Beispiel mit kurzen Trainings, Leitfäden oder regelmäßigen Reflexionsrunden mit anderen Führungskräften.
4) Vorleben: Nicht-Wissen und Fehler offen teilen
Für psychologische Sicherheit ist das Verhalten der Führungskräfte der stärkste Hebel. Wenn Du als Schichtleiter*in, Teamleitung oder Bereichsleitung so tust, als hättest Du immer alle Antworten, sendest Du eine klare – aber gefährliche – Botschaft: Unsicherheit ist nicht erlaubt. Dann werden Mitarbeitende erst recht keine kritischen Themen ansprechen.
"Wenn ich was nicht weiß, wirklich offen zu sagen: 'Du, ich weiß es gerade nicht. Hast du eine Idee?' – oder: 'Ich mache mich mal schlau und werde es euch beim nächsten Mal sagen.'" -- Yeter Cetinkilic, Bridgehouse
Der einfachste Gegenmove: Sag offen, wenn Du etwas nicht weißt, und bitte Dein Team um Ideen. Das kann bei einem neuen Arbeitszeitmodell sein, bei der Frage, wie ihr die digitale Zeiterfassung praxistauglich nutzt, oder bei der Umstellung auf vorbereitende Lohnabrechnung. Genau in diesen Momenten erleben Mitarbeitende: „Ich darf auch etwas nicht wissen – und trotzdem bin ich hier richtig.“
Gleiches gilt für eigene Fehler: Wenn eine Schicht falsch geplant war oder Überstunden aus dem Ruder gelaufen sind, benenne das, erkläre, was Du daraus lernst, und lade Dein Team ein: „Was würdet ihr anders machen?“ So entsteht Schritt für Schritt eine Fehlerkultur, in der Lernen wichtiger ist als Schuld.
Weitere Anregungen zu mentaler Gesundheit und Prävention findest Du hier.
5) Generationen verbinden statt gegeneinander stellen
In vielen Betrieben arbeiten heute mehrere Generationen zusammen: Kolleginnen, die seit 30 Jahren im Unternehmen sind, neben Berufseinsteigerinnen, die mit Smartphone, Emojis und Remote-Meetings aufgewachsen sind. Ohne psychologische Sicherheit werden daraus schnell Lager: „Die Jungen wollen nur Freizeit“ vs. „Die Alten blockieren alles“.
"Unterschiede sollten wir nicht als Bedrohung empfinden, sondern als natürliche Vielfalt, aus der wir lernen können." -- Yeter Cetinkilic, Bridgehouse
Stattdessen kannst Du die Unterschiede bewusst nutzen. Lass erfahrene Mitarbeitende erklären, warum bestimmte Sicherheitsroutinen, Schichtabläufe oder dokumentierte Prozesse so wichtig sind. Gleichzeitig können Jüngere Ideen einbringen, wie Ihr Kommunikation, Schichttausch oder Urlaubsplanung über mobile Apps leichter macht. Wichtig ist, dass alle erleben: Hier darf jeder beitragen – unabhängig von Alter, Titel oder Vertragsart.
Hilfreich sind einfache Formate: kurze Runden, in denen jede Generation schildert, was sie unter „Respekt“ oder „guter Führung“ versteht; Tandems, in denen Erfahrene und Jüngere sich gegenseitig einen Bereich zeigen; gemeinsame Regeln, wie ihr im Team sprecht, Feedback gebt und Konflikte klärt. Je sicherer der Rahmen, desto eher wird aus Reibung produktive Energie.